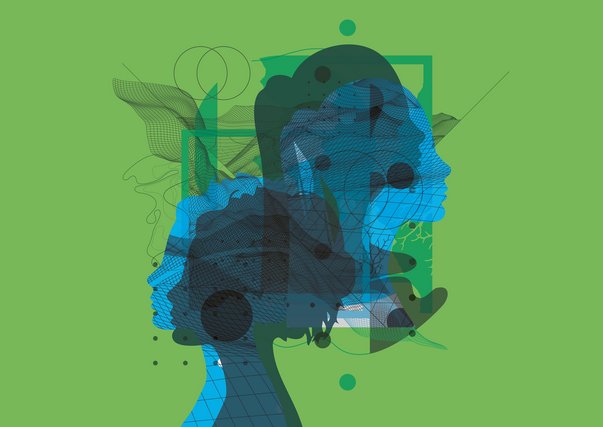
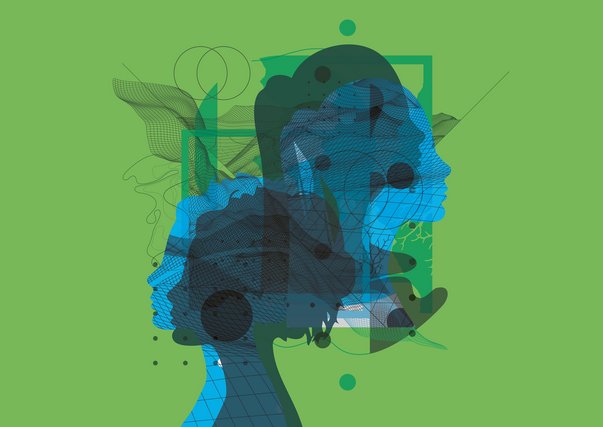
Einzelne Förderprogramme reichen nicht aus – es braucht systemische Veränderungen von der Bildung bis zur Arbeitswelt. Zu den zentralen Handlungsempfehlungen gehören:

«Bessere Koordination und strategischer Aufbau der MINT-Förderung sind Hebel dafür, bestehende Massnahmen zu optimieren. Sie sorgen dabei gleichzeitig auch für eine grösstmögliche Breitenwirkung.»
Susanne Metzger, Universität Basel
«Noch wenig genutzte Ansätze wie Gender Budgeting, nach dem Fördermittel und -initiativen auch Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigen, könnten ebenfalls dafür sorgen, dass sich der Frauen- und Mädchenanteil in MINT-Berufen steigert.»
Isabelle Collet, Universität GenfDie Studie entstand im Auftrag der SBFI im Rahmen des Postulats 22.3878 «Bericht und Strategie zur Steigerung des Frauenanteils in MINT-Berufen» und wurde im Zeitraum zwischen Januar und Oktober 2024 verfasst. Die Methodik der Studie beinhaltet Literaturanalysen, Analysen der Statistik sowie Fokusgruppen mit Akteur:innen aus Bildung, Politik und Wirtschaft. Das Ziel der Studie bestand darin, wirkungsvolle Handlungsempfehlungen für die Bildungspolitik und MINT-Akteur:innen zu formulieren.
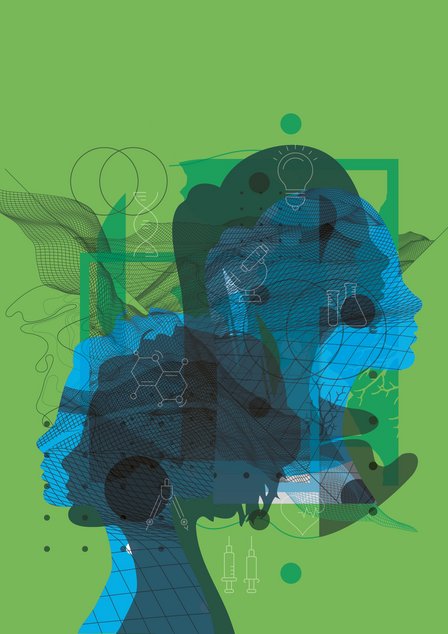
Edith Schnapper (SATW)
Isabelle Collet (Universität Genf), Susanne Metzger (Universität Basel, PH FHNW), Lora Naef (Universität Genf), Theres Paulsen (SCNAT, a+), Edith Schnapper (SATW), Stefan Vonschallen (PH FHNW)
Die Beitragsreihe zur Publikation beleuchtet das komplexe Thema MINT-Förderung aus verschiedenen Perspektiven:
Diese FAQs bieten einen kompakten Überblick über zentrale Themen und Fakten aus dem Originaltext. Sie hilft dabei, wichtige Inhalte verständlich zusammenzufassen, zentrale Aussagen zu klären und häufig gestellte Fragen gezielt zu beantworten.
Soziale Normen, Geschlechterstereotype und fehlende weibliche Vorbilder führen dazu, dass Mädchen sich oft weniger mit MINT identifizieren und ihre Fähigkeiten unterschätzen.
Lehrpläne, Unterrichtsmaterialien, die Haltung von Lehrpersonen und die Schulorganisation beeinflussen massgeblich, ob Kinder – insbesondere Mädchen – Interesse an MINT entwickeln.
Bildungsentscheidungen werden stark durch gesellschaftliche Erwartungen geprägt. Jungen tendieren zu technischen und produktionsnahen Berufen, Mädchen zu sozialen und dienstleistungsorientierten Feldern.
Ein geringeres Selbstvertrauen, stereotype Vorstellungen über technische Berufe, Sexismus im Ausbildungs- und Berufsalltag sowie schlechtere Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirken abschreckend.
Wirksam sind u. a. frühzeitige Förderung, gezielte Mädchenprogramme, Mentoring, Quoten, gendersensibler Unterricht, Vorbilder sowie die Veränderung institutioneller Rahmenbedingungen.
Durch praxisnahen Unterricht, spielerisches Lernen, experimentelle Formate, Bezug zur Lebenswelt und die Vermittlung von Sinn und gesellschaftlicher Relevanz technischer Berufe.
Notwendig sind vielfältige Zugänge zu Inhalten, barrierefreie Angebote, gendersensible Sprache und Didaktik sowie gezielte Ansprache unterrepräsentierter Gruppen.
Kinder aus bildungsfernen oder sozioökonomisch benachteiligten Familien haben geringere Chancen auf MINT-Bildung – etwa durch fehlendes Vorwissen, Sprachbarrieren oder begrenzten Zugang zu Förderprogrammen.
Es gibt ein deutliches Ungleichgewicht zwischen offenen Stellen und verfügbaren Fachkräften, besonders in Informatik, Technik und Ingenieurwesen – vor allem auf Fachhochschul- und Berufsbildungsebene.
Nötig sind eine koordinierte MINT-Strategie, strukturelle Gleichstellungsmassnahmen, Förderung von Vereinbarkeit, gezielte Investitionen in die Aus- und Weiterbildung sowie bessere Sichtbarkeit von MINT-Beiträgen in der Gesellschaft.